Zwischen zwei Welten: Gemeinsame Herausforderungen von Second:as in Bildung und Arbeitswelt in der Schweiz
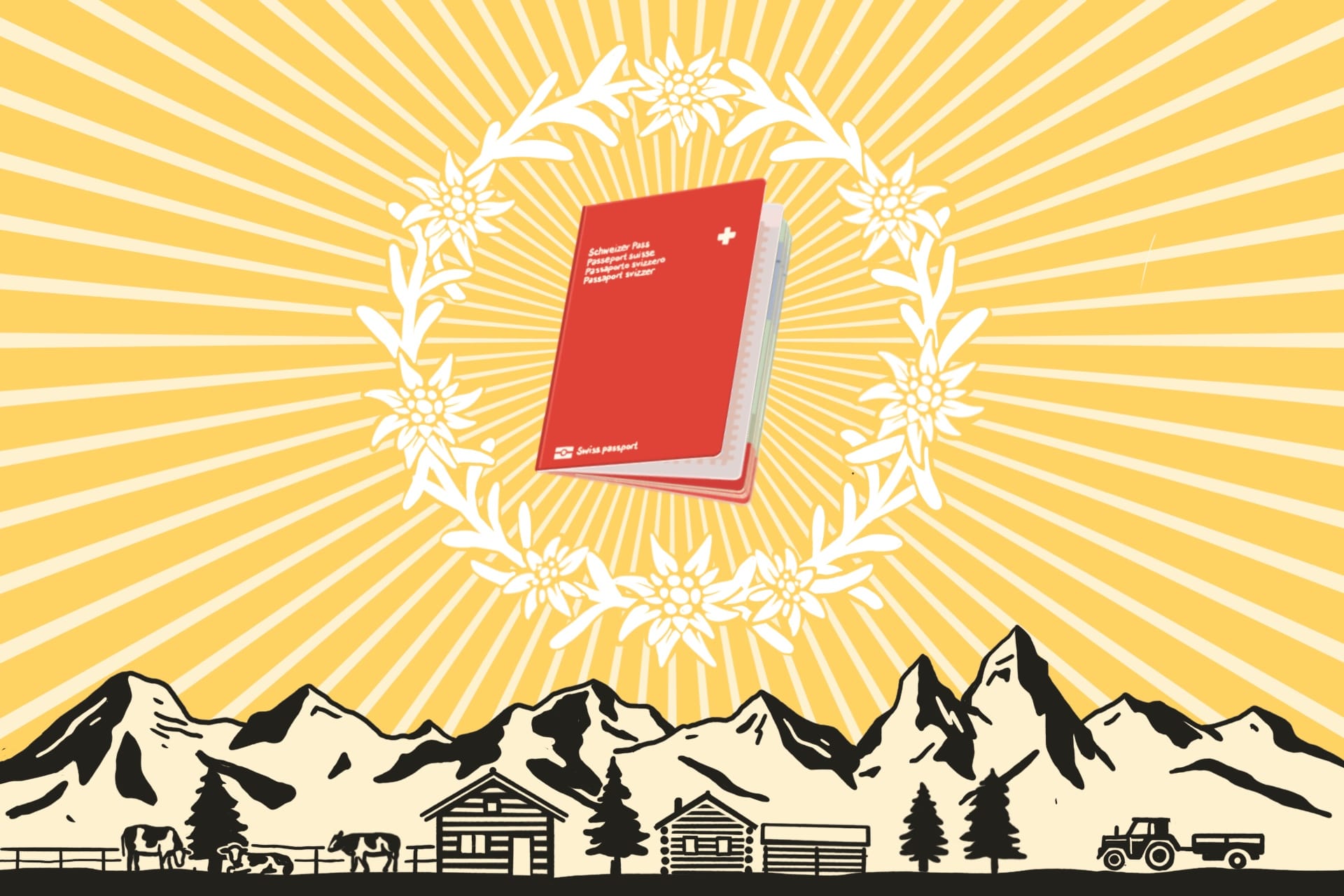
Bachelor-Thesis 2025
Zugehörigkeit ist keine Selbstverständlichkeit. Für Second:as – also Kinder der zweiten Migrationsgeneration – stellt sie oft eine Herausforderung dar. Obwohl sie in der Schweiz aufwachsen, erleben sie alltäglich, dass sie nicht ganz dazugehören. Sie bewegen sich zwischen zwei kulturellen Welten, sprechen oft mehrere Sprachen, übernehmen familiäre Verantwortung und vermitteln zwischen Herkunft und Mehrheitsgesellschaft. Doch genau diese doppelte Verankerung bringt Spannungen mit sich – insbesondere in Schule und Arbeitswelt.
Diese Bachelorarbeit widmet sich der Frage, welche strukturellen Hürden Second:as in der Schweiz konkret erleben und welche Faktoren ihre Chancen auf Bildung und berufliche Teilhabe beeinflussen. Im Zentrum stehen fünf qualitative Interviews mit jungen Erwachsenen aus Familien mit Migrationshintergrund. Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring, gestützt durch sozialwissenschaftliche Theorien zur Identität, Hybridität, Bildungsgerechtigkeit und Diskriminierung.
Die Ergebnisse zeigen ein widersprüchliches Bild: Second:as verfügen über zahlreiche Ressourcen – sie sind sprachlich versiert, interkulturell kompetent und oft hoch motiviert. Dennoch erfahren sie institutionelle und gesellschaftliche Barrieren, die ihren Bildungsweg und Berufseinstieg erschweren. Viele berichten von tiefen Erwartungen seitens Lehrpersonen, von verdeckter Benachteiligung im Bewerbungsprozess und von Unsicherheiten beim Zugang zu Informationen. Besonders in Übergangsphasen – vom Schulabschluss in die Lehre oder ins Studium, vom Praktikum in die feste Stelle – fehlen ihnen oft gezielte Unterstützung oder Orientierung.
Nicht selten übernehmen ältere Geschwister Rollen, die eigentlich Institutionen zukommen sollten: als Übersetzer:innen, Coach oder emotionale Stütze. Gleichzeitig wirkt der familiäre Erwartungsdruck ambivalent: Er kann Antrieb sein – oder zur Überforderung führen. Viele der Befragten betonen, dass sie sich ihren Platz im System härter erarbeiten mussten als ihre Peers ohne Migrationsgeschichte. Dabei geht es nicht nur um Leistung, sondern auch um Anerkennung.
Die Studie macht deutlich, dass Integration nicht allein eine Frage individueller Anpassung sein darf. Entscheidend ist, ob Schulen, Ausbildungsbetriebe und Unternehmen kulturelle Vielfalt nicht nur tolerieren, sondern aktiv wertschätzen und fördern. Bildungsgerechtigkeit entsteht nicht von selbst – sie ist das Ergebnis bewusster Strukturen, gezielter Massnahmen und gesellschaftlicher Offenheit.
Second:as leben nicht zwischen zwei Welten, sie verbinden sie – mit all der Spannung, aber auch mit dem Potenzial, das daraus entsteht. Damit dieses Potenzial Wirkung entfalten kann, braucht es mehr als persönliche Stärke. Es braucht faire Bedingungen.