Wie beeinflussen Beziehungen zu Mitarbeitenden das mentale Wohlbefinden von GründerInnen von Start-ups?
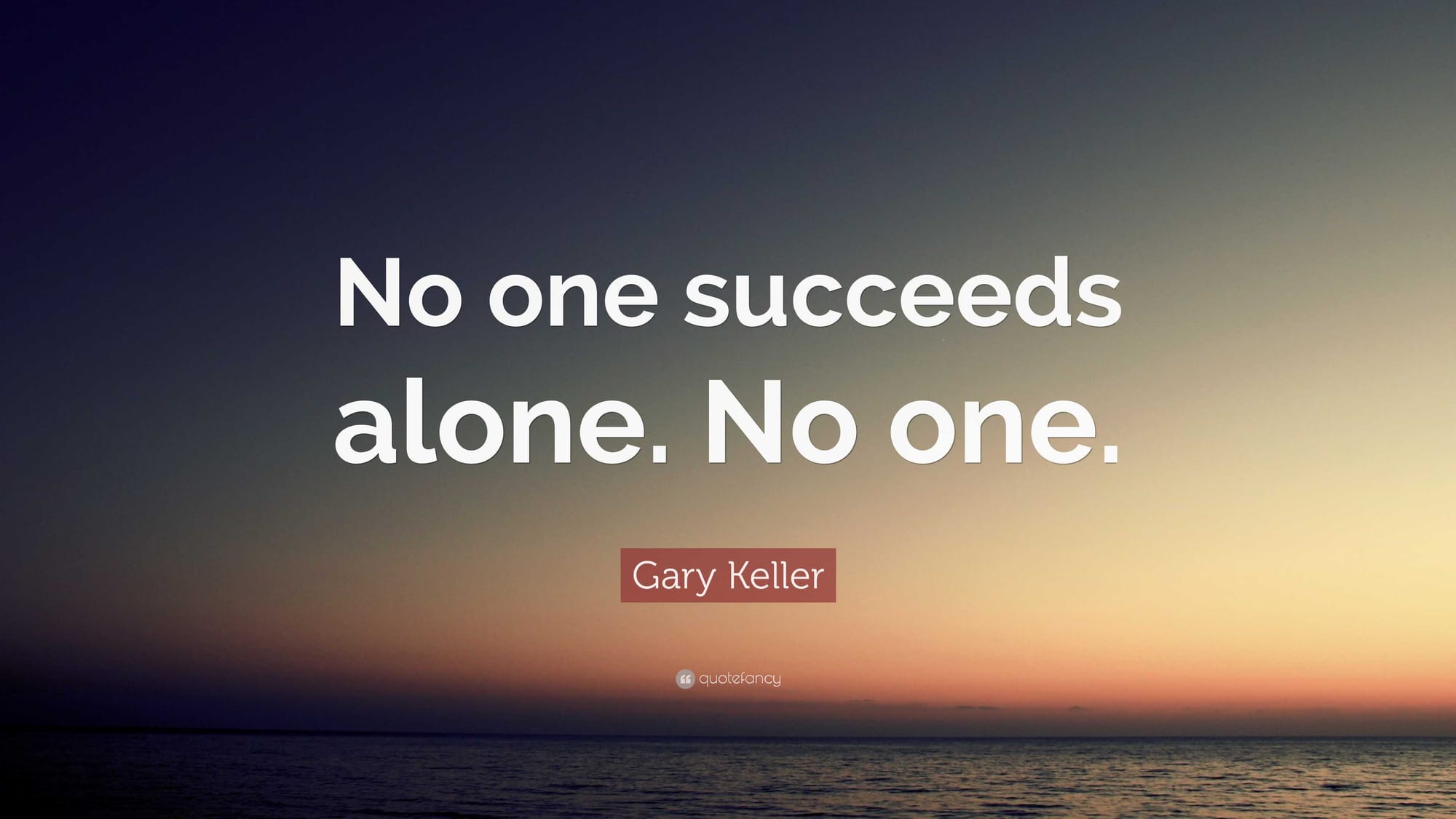
In der heutigen dynamischen Start-up-Welt sind GründerInnen mit hohen Anforderungen konfrontiert. So zählt das Unternehmertum zu den stressreichsten Berufen. Studien belegen, dass ein positives Arbeitsumfeld, das Unterstützung bietet, psychologischen Stress reduzieren und das mentale Wohlbefinden stärken kann. Das mentale Wohlbefinden von GründerInnen bildet somit ein zentrales Fundament für ein erfolgreiches Start-up. Während viele Studien die Bedeutung sozialer Unterstützung betonen, bleibt bislang weitgehend unbeantwortet, wie genau die Beziehungen zu Mitarbeitenden das mentale Wohlbefinden von GründerInnen beeinflussen. Gerade in Start-ups, die oft durch flache Hierarchien, enge Zusammenarbeit und eine hohe Dynamik geprägt sind, kommt der Qualität dieser Beziehungen eine besonders zentrale Rolle zu. Ziel dieser Arbeit ist es daher, zu untersuchen, wie GründerInnen ihre Beziehungen zu Mitarbeitenden erleben und wie sich diese auf ihr mentales Wohlbefinden auswirken.
Methodik:
Die qualitative Untersuchung basiert auf sieben leitfadengestützten Interviews mit GründerInnen aus unterschiedlichen Branchen in der Schweiz. Die Auswertung erfolgte mithilfe der Gioia-Methodologie, bei der First-Order-Konzepte, Second-Order-Themen und übergeordnete Aggregate Dimensions gebildet wurden. Ergänzend wurde ein Zusammenhangsmodell entwickelt, das die komplexe Wechselwirkung zwischen sozialer Unterstützung, Beziehungsqualität und Wohlbefinden abbildet.
Zentrale Ergebnisse:
Die Analyse zeigt, dass soziale Unterstützung nicht durchweg entlastend wirkt, sondern – abhängig von der Beziehungskonstellation – auch als Stressor erlebt werden kann. Es wurden fünf zentrale Ergebnisse identifiziert:
- Enge Beziehungen wirken als Moderator: Sie können einerseits wertvollen emotionalen Rückhalt bieten, andererseits jedoch auch dazu führen, dass GründerInnen die Belastungen ihrer Mitarbeitenden verstärkt miterleben – was sich wiederum negativ auf ihr eigenes Wohlbefinden auswirken kann.
- Soziale Unterstützung als Stressor: Emotionale Belastungen entstehen etwa durch das Gefühl einer Abhängigkeit von Mitarbeitenden, durch die emotionale Nähe enger Beziehungen oder durch unehrliches bzw. beschönigendes Feedback.
- Soziale Unterstützung als Ressource: Beziehungen, die von Vertrauen, klaren Verantwortlichkeiten und konstruktivem Feedback geprägt sind, fördern das mentale Wohlbefinden nachhaltig.
- Selbstwert und moralische Vorstellungen: Schuldgefühle können im Zusammenhang mit den Beziehungen zu Mitarbeitenden entstehen, wenn Autonomie oder das Nichthinzuziehen von Hilfe im Widerspruch zu inneren Idealen steht.
- Spannungsfeld durch Rollenkonflikte: Beteiligungen durch Aktien oder Umsatzbeteiligungen an Mitarbeitenden können hierbei als wirkungsvoller Hebel zur Gestaltung von Beziehungen dienen, indem sie Identifikation, Verantwortungsgefühl und ein gemeinsames Interesse am Erfolg des Start-ups fördert.
Handlungsempfehlungen:
Konkrete Handlungsempfehlungen lassen sich nur bedingt ableiten, da sich die Beziehungen zwischen GründerInnen und Mitarbeitenden als vielschichtig und komplex erwiesen haben. Enge Beziehungen können einerseits wertvollen emotionalen Rückhalt bieten, andererseits führen sie auch dazu, dass GründerInnen die Probleme und Belastungen ihrer Mitarbeitenden intensiver wahrnehmen – was wiederum das eigene Wohlbefinden beeinträchtigen kann.
Im Verlauf der Analyse wurde jedoch deutlich, wie zentral Feedback für das mentale Wohlbefinden von GründerInnen ist – insbesondere dann, wenn es in einer Form kommuniziert wird, die zur empfangenden Person passt. Dabei zeigte sich, dass nicht nur der Inhalt, sondern auch die Verpackung des Feedbacks entscheidend für dessen Wirkung ist. Eine konkrete Handlungsempfehlung besteht daher darin, mit Mitarbeitenden offen zu besprechen, in welcher Form Rückmeldungen gegeben werden sollen. Dadurch kann das Potenzial von Feedback besser ausgeschöpft und das Risiko negativer Wirkungen auf das Wohlbefinden reduziert werden.